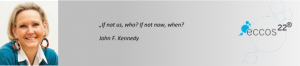
Co2-Ausstoß, ein strategisches Top-Thema
Seit dem Pariser Klimagipfel im Jahr 2015 ist der Co2-Ausstoß ein Dauerthema, sowohl für die Politik, als auch für Unternehmen. Co2-Fußabdruck, Co2-Bilanzen, Co2-Berechnungen beschäftigen alle und jeden, bis hin zu Privatpersonen. Und das Ziel des EU Green Deal, bis 2050 klimaneutral zu werden, befeuert die Diskussion seit Jahresende 2019 weiter. Aber was brauchen Unternehmen, um die Erreichung des Pariser Klimaziels von 1,5 Grad bzw. max. 2 Grad zu unterstützen und in Europa bis 2050 klimaneutral zu agieren?
Politische Vorgaben
Der anthropogene Klimawandel wird inzwischen kaum mehr in Frage gestellt, denn die Klimaerwärmung hängt direkt mit unserer Wirtschaft und unserem Konsumverhalten zusammen. Daher hatte sich die internationale Staatengemeinschaft 2015 in Paris darauf geeinigt, die Erwärmung auf 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Werten zu halten, mit einem absoluten Maximalziel von 2 Grad. In den Folgejahren wurde das Abkommen von allen Staaten ratifiziert, der Austritt Donald Trump’s von Joe Biden als eine der ersten Amtshandlungen des amtieren US-Präsidenten am 20. Jänner 2021 wieder zurückgenommen. Für die Begleitung sowohl des Pariser Klimaabkommens als auch des Kyoto-Protokolls zeichnet das Sekretariat des UNCC (United Nations Climate Change) verantwortlich, das das UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) umsetzen soll.
Die EU Kommission unter Ursula von der Leyen arbeitet sehr aktiv an Vorgaben und Verordnungen, um in Europa die richtigen Weichen zu stellen – darüber berichten wir laufend. Der Umbau unserer Wirtschaft in Richtung Kreislauffähigkeit (Circular Economy Action Plan) soll dabei helfen, 50% der Co2-Emissionen einzusparen, die anderen 50% werden über die sieben Kernthemen (saubere Energie, nachhaltige Industrie, Bauen und Renovieren von Gebäuden, nachhaltige Mobilität, vom Hof auf den Tisch, Biodiversität sowie Reduktion der Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden) abgedeckt. Zum Klimathema hat die EU Kommission im Februar 2021 die neue EU-Strategie für die Anpassung an den Klimawandel veröffentlicht. Über die EU-Klimapläne werden wir im Detail in einem separaten #breakthroughthursday-Beitrag berichten. Selbstverständlich ist der Klimawandel auch in den Umweltzielen der kürzlich zusammengefassten EU-Taxonomieverordnung adressiert.
Die ambitionierten Ziele der EU müssen natürlich auch in Österreich umgesetzt werden. Diese sind in der „Langfriststrategie 2050 – Österreich“ des damaligen BM für Nachhaltigkeit und Tourismus aus dem Jahr 2019 nachzulesen.
Rechtzeitig zum G7-Treffen im Juni erschien eine Studie der Science Based Targets initiative (SBTi), vorbereitet von UN Global Compact und Carbon Disclosure Project (CDP). Darin wurden die führenden Börsenindizes der G7-Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, UK, Kanada und USA auf Basis der Ziele zur Emissionsreduktion untersucht, die Unternehmen an CDP bzw. SBTi gemeldet hatten. Aufgrund der Vorgabe, Emissionen bis 2030 zu halbieren, wurden eher kurz- und mittelfristige Ziele herangezogen. Die schlechte Nachricht: diese Daten sind weit entfernt, das 2-Grad-Ziel zu erreichen, geschweige denn 1,5-Grad.

Politik und Finanzwirtschaft müssen ihre Ambitionen daher deutlich erhöhen, um die gesetzten Ziele und damit eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe zu erreichen. Die vorgenannten Anstrengungen der EU, v.a. die Taxonomieverordnung, sind dafür ein deutliches Zeichen.
Umsetzung in Unternehmen
Die genannten Rahmenbedingungen führen dazu, dass immer mehr Unternehmen ihren Co2-Ausstoß erheben. Das kann anhand von zwei weltweit anerkannten Vorgaben durchgeführt werden – entweder über die internationale Leitlinie Greenhouse Gas Protocol (GHG) oder die daran angelehnte international gültige Norm ISO 14064/ 14067 (Treibhausgasbilanz).
Das GHG Protocol umfasst Berechnung und Reporting jener sieben Treibhausgase, die im Kyoto Protocol aufgeführt sind: Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFCs), Schwefelhexafluorid (SF6) und Stickstofftrifluorid (NF3). Üblicherweise werden zur Vereinfachung alle Emissionen in Co2-Equivalente umgerechnet. Unternehmen identifizieren zur Errechnung ihrer Emissionen innerhalb der Organisationsgrenzen jene Emissionsquellen, die bei der Leistungserbringung im Unternehmen entstehen. Alle anderen Emissionen aus Quellen außerhalb der Grenzen zählen zu den indirekten Emissionen.
GHG Protocol-Standards unterscheiden drei Bereiche (Scopes), denen Emissionen zugeordnet werden können:
- Scope 1 = alle direkten, d. h. aus Quellen innerhalb der Grenzen stammenden, Emissionen.
- Scope 2 = die indirekten Emissionen aus außerhalb erzeugtem und eingekauftem Strom, Dampf, Wärme und Kälte.
- Scope 3 = alle sonstigen indirekten Emissionen, darunter die aus Herstellung bzw. Transport eingekaufter Güter oder Verteilung und Nutzung der eigenen Produkte oder der Entsorgung von Abfällen sowie Emissionen aufgrund von Geschäftsreisen.
Die ISO 14064-1 unterstützt Unternehmen dabei, die Treibhausgasemissionen in einem Corporate Carbon Footprint (CCF) strukturiert zu erfassen und in der Folge gezielt den CO2-Fußabdruck zu verringern. Dies bietet den Rahmen zur THG-Bilanzierung sowie deren Verifizierung und bildet die Basis für eine belastbare Berichterstattung. Die ISO 14064-2 ist eine Anleitung für die Erfassung von Treibhausgasen oder die Reduzierung von Emissionen auf Projektebene. Mittels ISO 14064-3 erhalten Unternehmen die Grundlage für die Verifizierung von CO2-Bilanzen. Anhand der ISO 14067 können Unternehmen die Co2-Bilanz ihrer Produkte erfassen. Damit liegt seitens der International Standards Organisation (ISO) ein vollständiges Framework vor, wie Unternehmen ihre Co2-Berechnungen sowohl für die gesamte Organisation als auch auf Projekt- bzw. Produktebene durchführen können. Zusätzliche Vorteile von ISO-Standards liegen in der globalen Vergleichbarkeit der erfassten Daten. Unser eccos²²®-Zertifizierungspartner, die Quality Austria, kann umfassende Expertise im diesem Bereich vorweisen.
In den letzten Jahren sind darüber hinaus zahlreiche Initiativen entstanden, die im Anschluss an die Erhebung des Co2-Ausstoßes auch gleich Möglichkeiten zur Kompensation anbieten. Dies sollte jedoch nur der letzte Schritt sein, nachdem alle Treibhausgasemissionen auf das absolute Minimum reduziert werden konnten. Denn die optimale Vorgehensweise lautet: erheben, reduzieren und erst dann kompensieren. Vorsicht ist auch bei manchen Kompensationsprojekten geboten. Hier empfiehlt sich ebenfalls – wenn möglich – persönliche Überprüfung der Maßnahmen, andernfalls eine Orientierung an den diesbezüglichen Zertifizierungen namhafter Organisationen für die ausgelobten Projekte.
Abschließend weisen wir noch auf unsere eccos²²®-Angebote hin und freuen uns auf Ihr Interesse! Die Details zu unserem nächsten Online-Lehrgang Ende September/Anfang Oktober 2021 sind bereits auf unserer Webpage verfügbar. Ein letzter Durchgang 2021 ist für 9. + 11., bzw. 16. + 18. November vorgesehen, in-house Lehrgänge für Unternehmen werden maßgeschneidert angeboten.





